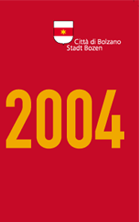02/09/2004
Interview mit Lilya Zilberstein
„Ich stelle mir die russische Landschaft vor...“
Lilya Zilberstein, 1965 in Moskau geboren, trat am vergangenen Sonntag mit großem Erfolg im Rahmen des Festivals Bozen/Klavierfestival Busoni in einem Soloabend mit Werken von Clementi, Liszt und Rachmaninov auf. Die russische Pianistin über das Bozner Publikum, die Bedeutung des Busoni-Preises und ihre Vorliebe für Rachmnainov.
Frau Zilberstein, Sie sind beim Bozner Publikum sehr beliebt, wie viel Einfluss hat das Publikum auf die Qualität ihres Konzertes?
Normalerweise spielt das Publikum für mich keine große Rolle. Wenn ich spiele, fühle ich mich ziemlich unabhängig von den Leuten, die im Saal sitzen. Allerdings ist das hier in Bozen schon etwas anders. In Bozen fühle ich mich beheimatet. Für mich ist es immer ungemein aufregend hier zu spielen. Ich fühle mich wie die 22-jährige Lilya, die 1987 hier zum ersten Mal in Bozen aufgetreten ist. Der Konservatoriumssaal ist ein besonderer Saal für mich. Und das Konzert vorige Woche beim Klavierfestival war für mich schon besonders aufregend. Es gab ein hochkompetentes Publikum, die Jurymitglieder, die Busoni-Kandidaten, Kritiker und Freunde. Sie alle kenne ich gut. Die Musik, die spielte ich für sie, sie hatte konkrete Bezugspersonen. Aber auch wenn ich in einer fremden Stadt spiele, gebe ich immer alles, 100 Prozent.
Was bedeutete für Sie der 1. Preis beim Busoni-Wettbewerb?
Der bedeutete den Start meiner beruflichen Karriere. Ohne Busoni-Preis wäre mein Leben in eine völlig andere Richtung verlaufen. Ich hatte damals in der Sowjetunion bei verschiedensten Wettbewerben teilgenommen, aber es hat nie geklappt. Und dann hat sich das ergeben mit der Teilnahme am Busoni-Wettbewerb. Das war die einzige Möglichkeit aus der Sowjetunion hinauszukommen. Wir haben das damals alle nicht für möglich gehalten: Ich habe den Preis gewonnen und er öffnete mir das Leben.
Wie nähern Sie sich einem Werk? Versuchen sie vor allem den Kompositionsvorgang nachzuvollziehen oder das Erlebnis der Persönlichkeit des Komponisten im Vortrag zu vermitteln?
Zum Werk von Rachmaninov habe ich beispielsweise einen besonderen Bezug. Ich habe alle seine Werke gespielt. Dieses Jahr in München die vier Klavierkonzerte, die Paganini-Rhapsodie in einem Monat. Rachmaninovs Musik kenne ich besser als jede andere. Da fühle ich mich besonders hingezogen und sehr verbunden. Er ist bereits ein Teil von mir selbst, ich fühle es mittlerweile so, als ob ich das geschrieben hätte. Und ich kenne die Werke sehr gut. In der Vorbereitung geht vieles über die Intuition. Ich stelle mir die russische Landschaft vor, meine Heimat, die Menschen dort.
Gibt es das Werk eines Komponisten, wo Sie sagen, den haben Sie bis jetzt nicht so wahr genommen und mit dem möchten Sie sich in Zukunft näher auseinander setzen?
Da würde ich jetzt keinen bestimmten Komponisten nennen, aber die zeitgenössische Musik im Allgemeinen, zu ihr habe ich keinen großen Zugang, z.B. Schnittke, Gubaidulina und Berio. Während meiner ganzen Ausbildung in Russland wurde ich nie mit modernen Komponisten konfrontiert. Das war damals alles unbekannt. Man müsste sich wirklich intensiv damit beschäftigen und dafür fehlt mir irgendetwas, keine Ahnung vielleicht die Zeit oder das wirklich große Interesse. Aber wer weiß...
Klavierspielen als Job – verfällt man irgendwann einer Routine?
Es ist wie wenn man geht und nicht merkt, dass man geht. Das ist auch irgendwie Routine, aber tut es oder muss es tun. Beim Klavierspielen ist das ähnlich. Ich glaube, dass das richtige Gefühl es verhindert, dass es Routine wird.
Gibt es außerhalb der Musik noch andere Dinge, die Ihnen Freude bereiten und die Sie für Ihre Ausgeglichenheit brauchen?
Ja meine Familie. Meine beiden Kinder und mein Mann sind für mich so wichtig wie das Klavierspielen.
Interview: Verena Gruber
26/08/2004
„Seit dem Busoni-Preis fühlte ich mich als richtige Pianistin“
Ein Gespräch mit der amerikanischen Pianistin Ursula Oppens, die im Rahmen des Klavierfestivals Ferruccio Busoni „Dialogues“ von Elliot Carter mit dem Haydn-Orchester unter der Leitung von Ola Rudner in einer italienischen Erstaufführung spielt.
Frau Oppens, sie haben im fernen Jahr 1969 den Busoni-Preis gewonnen und sind vor drei Jahren als Jurymitglied wieder zum Wettbewerb nach Bozen zurückgekehrt. Wie haben sie diese beiden unterschiedlichen Rollen, jene der Kandidatin und des Jurymitglieds, erlebt?
Jedes Mal, wenn ich in Bozen verweile, bin begeistert von der Natur, Landschaft und Architektur dieses Landes und der Stadt. Hier ist es wunderschön. Und ich denke das hat damals wesentlich dazu beigetragen, dass ich diesen Preis gewonnen habe. Es hat mir hier so gefallen und ich war so glücklich, dieses Glück konnte ich der Jury vermitteln. Der Busoni-Wettbewerb war mein erster wichtiger internationaler Wettbewerb. Ich kam damals nicht direkt aus New York, sondern studierte bei Guidi Agosti an der Accademia Chigiana.
Als Kandidatin stellt man sich die Mitgliedschaft in einer Jury ganz anders vor. Als Jurymitglied kam ich mir nicht so mächtig vor. Vorher dachte ich immer, eine Jury muss sich so überlegen und souverän fühlen. Ich spürte in der Jury diese große Verantwortung und war immer wieder von Unsicherheit gequält. Man hört so viele wunderbare Pianisten und es überkommt einen oft Angst, dass das gefällte Urteil nicht gerecht sein könnte. Ein Kandidat kann kaum vermuten, wie schwierig diese Aufgabe der Jury ist. Ein Jurymitglied muss über sehr viel Intuition verfügen. Manchmal passiert es, dass man sich erst am Ende bewusst, dass das anfängliche Urteil nicht richtig war.
Wie hat der Busoni-Preis ihr Leben verändert? Was hat sich Vergleich zu vor 30 Jahren verändert?
Der erster Preis hat meine Rolle als Pianistin, mein Selbstverständnis als Pianistin vollkommenen verändert. Seit diesem Preis habe ich mich wirklich als Pianistin empfunden. Es war für mich, als wenn ich die Doktorwürde erhalten hätte. Natürlich gibt es heute viel mehr Wettbewerbe als 1969, aber trotzdem glaube ich, dass es immer ein wichtiger Schritt war, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Vermutlich spielte es vor 30 Jahren eine noch wichtigere Rolle, weil es einfach wenigerer Wettbewerbe gegeben hat und damit weiniger Möglichkeiten.
Es verbindet sie ein ganz besonderes Verhältnis zum amerikanischen Komponisten Elliott Carter...
Ich spielte die erste Komposition von Carter im Jahre 1966 - Quartett für Flöte, Oboe, Cello und Cembalo. Seine Arbeit ist in all den Jahren ausgereifter, klarer und purer geworden – auch in emotionaler Hinsicht. Ich liebe alles, was Carter komponiert hat. Aber ich glaube, dass beispielsweise „Dialogues“ für viele Zuhörer, die noch nie etwas von Carter gehört hat, sehr geeignet ist, um einen Zugang zu diesem Komponisten zu finden. Das stück besticht durch seine Klarheit, es ist unglaublich lyrisch und hat auch viele verschiedene virtuose Elemente. Für Klavier gibt es von Carter noch das 1978 komponierte wunderbare Klavierkonzert, ein Doppelkonzert für Klavier und Cembalo und Dialogues ist das dritte Werk dieser Gattung. 1999 hat mir Elliott 2 Werke für Soloklavier gewidmet und ein Klavierquintett für mich und das Arditti-Quartett.
In „Dialogues“ tritt das Klavier in Dialog mit dem Orchester . Können Sie etwas zu diesem Stück erzählen?
Es ist ein perfektes Stück für ein Kammerorchester mit klassischem Orchesterkörper so wie es das Haydn-Orchester ist. Die Komposition beginnt mit einem herrlichen Hornsolo und dann setzt das Klavier ein, so wie es für Carter typisch ist – es wird gleich die gesamte Tastatur in Anspruch genommen. Das Instrument ist hier sehr präsent. Das Konzert hat viele Formen. Es ist sehr lyrisch, mit einem Scherzo in der Mitte, und einer sehr virtuosen Coda. Ein wunderbares Stück.
Wie wichtig sind heutzutage Wettbewerbe für junge Pianisten?
Die Wettbewerbe sind sehr wichtig und stellen eine eigene Welt, eine Welt für sich dar. Sie sind quasi eine Konzertform. Denn die Prüfungen können von einem Publikum gehört werden. Und ein Interesse für junge Pianisten entsteht. Ich glaube, dass ein Wettbewerb in einer gewissen Weise auch sehr demokratisch sind. Jeder hat die Möglichkeit, wenn er will, seine Arbeit zu präsentieren. Es findet ein Austausch statt zwischen jungen Pianisten und Pianisten mit Erfahrung. Jeder kann zuhören und seine eigene Meinung bilden. Und letztendlich ist ein Wettbewerb für einen jungen Pianisten äußerst wichtig, um seine eigenen Beruf zu finden, seine Berufung zu erkennen.
Interview: Verena Gruber und Daniela Rodriguez
|